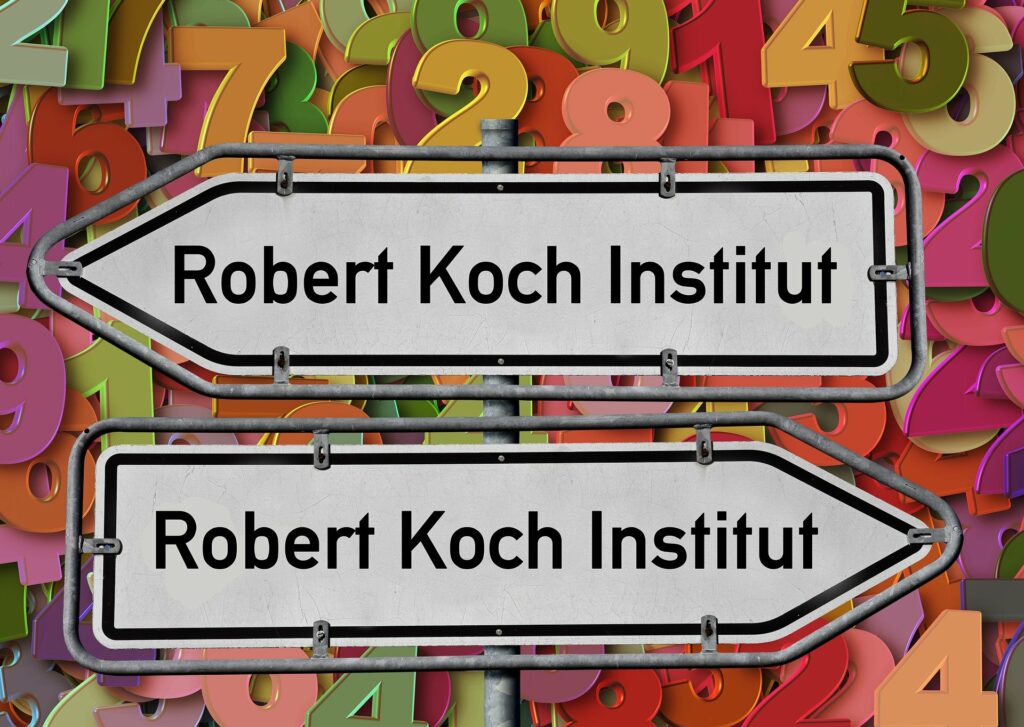Ein im Juni erschienenes Sauerland-Buch vermittelt einen geschichtlichen Überblick zu Wilderei und Waldkonflikten in Südwestfalen. Beim „Krieg im Wald“ ging es um Brennholz und Fleisch. Wildschütz-Abenteuer blieben dagegen eher die Ausnahme. Weil bei Zusammenstößen eine Waffe zuhanden war, mussten immer wieder Menschen ihr Leben lassen. Es gab auf beiden Seiten der „Waldfront“ gefährlichen Gruppenzwang und Akteure, die keine Skrupel kannten. Meistens jedoch waren Angst und Panik die Auslöser von tödlichen Schüssen.
Zu den Opfern zählten arme Schlucker oder Forstbedienstete, die zumeist auch nicht dem Kreis der Privilegierten angehörten. Auf beiden Seiten wurden Tränen vergossen. Wer den Standort der Menschlichkeit einnimmt, wird jenseits von einseitigen Parteinahmen die Leiden aller Beteiligten würdigen. Der „Krieg im Wald“ sollte nicht romantisch verklärt oder moralisiert, sondern als ein Kapitel der regionalen Sozialgeschichte beleuchtet.
Peter Bürger (Hg.): Krieg im Wald
Forstfrevel, Wilddiebe und tödliche Konflikte in Südwestfalen.
Norderstedt 2018. ISBN-13: 9783746019116; 308 Seiten; Preis: 18,90 Euro
https://www.bod.de/buchshop/krieg-im-wald-peter-buerger-9783746019116
Das Buch kann überall vor Ort im Buchhandel bestellt werden.

Feudale Zeiten: Die adeligen Herren liebten es nicht, wenn die Untertanen auf Jagd gingen
(Aus dem neuen Buch „Krieg im Wald“)
Im alten, „geistlich“ regierten Herzogtum Westfalen, welches das ganze kölnische Sauerland umfasste, scheint das Jagen eine allseits beliebte, wenn auch keineswegs allen erlaubte Angelegenheit gewesen zu sein. Schon Mitte des 15. Jahrhunderts stellte der Wedinghauser Konventuale Ludolf von Bönen, eine schillernde Gestalt, „anstatt im Chor die Messe zu lesen, lieber in Wald und Feld den Wölfen und Füchsen nach“ (Kanonikus Degenhard Schüngel soll seinen Jagdfalken gar mit in die Kirche gebracht haben); später betätigte sich z.B. auch der Oelinghauser Probst Johannes Sundag (1552-1561) als leidenschaftlicher Jäger.
Den sauerländischen Pastoren musste aus gegebenem Anlass „die Jagd auf Rehwild, Hasen und Feldhühner mit Jagd- und Hühnerhunden sowie das Fischen bei Nacht und sogar an Sonn- und Feiertagen“ ausdrücklich verboten werden. Einige Klosterkleriker genossen freilich wie die Edelherren vor der Säkularisation von 1803 ganz ungeniert Jagdprivilegien. Von Ferdinand Krevet, der bis zu seinem Tod 1821 als Pfarrer in Düdinghausen wirkte und „einstmals Mönch zu Glindfeld gewesen war, wird berichtet, dass in Waldeck auf seine Ergreifung beim Jagen ein Kopfgeld von 80 Talern ausgesetzt war. Er konnte sich anscheinend nicht damit abfinden, dass die früheren Rechte der Klosterherren ersatzlos gestrichen sein sollten“.
Vom gemeinen Mann, dem Untertan, erwartete man Jagdfrondienste, aber keine Jagdkünste. Schon 1616 klagten Adelige des Herzogtums über Bauern, die sich um die Privilegien der Ritterschaft nicht scheren und ohne Berechtigung fischen oder jagen würden. Wiederholte Erlasse gegen Wilderei und z.T. sehr harte Strafen sollten das Übel abwehren: Am 27. Februar 1659 verfügte der kölnische Kurfürst als Landesherr über den Umgang mit Wilddieben: „Wir halten dafür, dass solcher Frevler auf einen von Holz gemachten Hirsch mit an den Füßen gehenkten Gewichten etliche Tage nacheinander Stunden lang gesetzt, demnächst des Landes verwiesen und falls er wieder (beim Wilddieben) ertappt, mit mehr Schärfe, ja nach Befinden gar an dem Leben gestraft werde.“
Der prachtliebende und jagdbesessene Kurfürst Clemens August, von 1723 bis 1761 Erz-„Bischof“ von Köln, verfügte sogar sehr bald nach seinem Amtsantritt am 4. Dezember 1723: „Da sich die Wilddiebereien durch Abstrafung mittels Eselreitens, spanischen Mantels nicht vermindert, sondern durch so milde [!] Strafen eher verstärkt würden: so solle der Jägermeister die ertappten Wilderer durch 100, 200, 300 Bauern Spießruten laufen lassen […]. Am 7. September 1724 wies derselbe Kurfürst seine Jäger bei Strafe der Amtsenthebung an, auf ertappte Wilddiebe, wenn sie beim ersten Anruf nicht stehenblieben oder sich ergeben wollten, ‚sogleich Feuer zu geben und sich derselben zu bemächtigen‘ […]. Wilddiebe wurde im Hirschberger Schlossgefängnis eingeschlossen, sie mussten sich selbst beköstigen oder erhielten Wasser und Brot. […] In Wiederholungsfällen und bei ganz Übelberüchtigten wurde an die Bonner Hofkammer berichtet, worauf ‚mehrteils Abgabe des Denunziaten in entfernte lebenslängliche Militärdienste, Landesverweisung oder lebenslängliche Zuchthausstrafe erfolgte und zur Bestreitung der Kosten sogar sein Vermögen verwandt wurde‘ “. Somit war erwiesen, was ein in adeliger Jagdkunst geübter Kölner ‚Erzbischof‘ unter christlicher Milde verstehen konnte.
Die Grausamkeit einiger feudaler Landesherren in deutschen Landen, darunter eben auch die von sogenannten ‚Bischöfen‘ der Kirche Jesu Christi, kannte bisweilen bei der Verfolgung von Wildfrevel keine Grenzen: Wilderer wurden an Hirsche festgeschmiedet und so ins Verderben geschickt. Augen wurden ausgestochen und Hände abgehackt. Auf die Stirn kam ein Brandmal in Geweihform. Aufhängen oder Totschießen ohne Gerichtsverfahren galten mancherorts bis ins 17. Jahrhundert hinein als ganz normal. Es konnte so scheinen, als sei in den Augen der hohen Herrschaften das unbefugte Erlegen eines „ihrer“ Waldtiere schlimmer als ein Menschenmord.
In der Nachbarschaft zum Herzogtum Westfalen, so etwa im Waldeckischen, war man auch nicht besonders zimperlich. Kurkölnisch-sauerländische Holzfrevler aus dem Raum Olpe hatten 1727 bei Grenzüberschreitungen in Gebiete des Fürstentums Nassau-Siegen keine Gnade zu erwarten. Dort waren die Hochfürstlichen Heckenknechte und Jäger angewiesen, „diejenigen, welche etwa nach verübten Holtzschaden der pfändung entfliehen mögten und keinen stand halten wollten, ohne Ansehen zu erschießen“. 1797 klagte die Berleburger Regierung beim Landdrosten und bei den Räten in Arnsberg über häufige Wilddiebereien durch Einwohner des Amtes Bilstein: Man habe „die kräftigsten Gegenanstalten getroffen“, so „dass die betroffenen wilddiebe sich sogar des verlustes ihres Lebens dabei bloß stellen“. Pfarrer Johann Georg Arens aus Heinsberg warnte seine Schäfchen: „Stehlt kein Wild! – die Berleburger schießen euch todt!“
Mehrere freie Städte im Herzogtum beanspruchten und verteidigten nun allerdings mannigfache Jagdrechte ihrer Bürgerschaft. Namentlich für Rüthen wird von sehr weitgehenden Holz-, Hude-, Jagd- und Fischereirechten berichtet: „Während sonst die hohe Jagd nur dem Adel und den Landesherren zustand, besaß in Rüthen jeder Bürger das Jagdrecht. Er durfte jagen, wo und wie oft er wollte, und das erlegte Wild für sich verwenden. In der Regel fanden jährlich mehrere Treibjagden statt, an denen alle Bürger teilnehmen konnten.“ Obwohl in den 1597 aufgezeichneten Freiheiten des Amtes Bilstein den Untertanen allenfalls die Jagd auf Füchse und Hasen zugestanden wird, betrachteten viele Bewohner noch um 1800 auch das Erlegen von Rehen oder sogar Hirschen als gewohnheitsrechtliche Angelegenheit: „Der um sein alleiniges Jagdrecht besorgte Freiherr von Fürstenberg versuchte, die Einsassen, die in den Kirchspielen Heinsberg, Kirchhundem und Kohlhagen zur Jagd gingen, als Wilddiebe hinzustellen.“ (Martin Vormberg) Die Bewohner hielten ihre – keineswegs heimlich ausgeführte – Mitjagd schon deshalb für notwendig, um den Schaden an ihren Wiesen und Feldern in Grenzen halten zu können. Die Heinsberger beantworteten ein von den Kanzeln verkündetes Verbot des Freiherrn sogar damit, „dass sie nun gerade allesamt auf die Jagd gingen“.
Für exklusive Jagdprivilegien von ‚Edelherren‘ und daraus resultierende Nachteile gab es gegen Ende des Herzogtums Westfalen bei vielen Landeskindern offenbar kaum noch Verständnis. Eine kurkölnische Kommission zur Untersuchung der vom Wild angerichteten Flur- und Feldverwüstungen hatte schon 1735 die diesbezüglichen Klagen der Arnsberger Bürgerschaft als „völlig begründet“ erachtet. 1794 schrieb auch die kurfürstliche Hofkammer von Brilon aus an den Landesherrn, Nachsicht gegen die vom Wild angerichteten Verheerungen in den Feldern der Untertanen passten nicht zu aufgeklärten Zeiten, sondern seien ein „Überbleibsel jener finsteren Ära, wo derlei Tiere zum Bedruck des Landmannes gemästet und Menschen wie Tiere behandelt wurden“. Eine „Verzäunung der Waldungen“ war vorgesehen, und eine Verordnung des Kurfürsten Max Franz vom 30.4.1793 hatte in diesem Zusammenhang bestimmt, „dass die Jagdbedienten für den Schaden, der dem Landmann vom Wilde an seinen Früchten zugefügt würde, haften sollten“. Die Waidmannslust lag somit bei den Herren oben, die Verantwortung für unerfreuliche Begleiterscheinungen wurde auf bedienstete, mit der Wildaufsicht beauftragte Untertanen abgewälzt.
Für eine Aufhebung des feudalen Jagdrechtes auf dem Grund bäuerlicher Landbesitzer haben sich Jahrzehnte später als Abgeordnete der Jurist Johann Matthias Gierse (1807-1881) aus Gellinghausen bei Meschede und auch der Kirchhundemer „Bauernadvokat“ Johann Friedrich Joseph Sommer (1793-1856) stark gemacht.